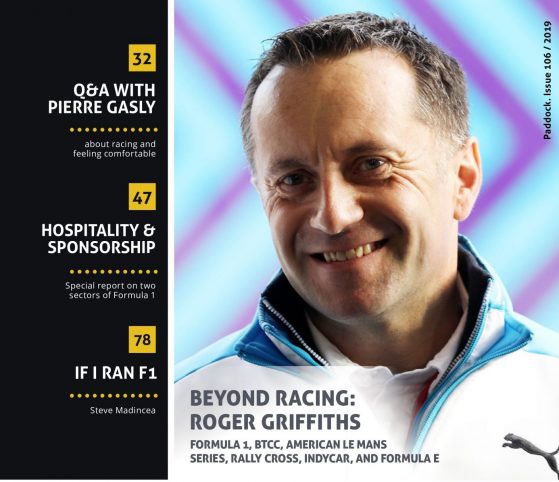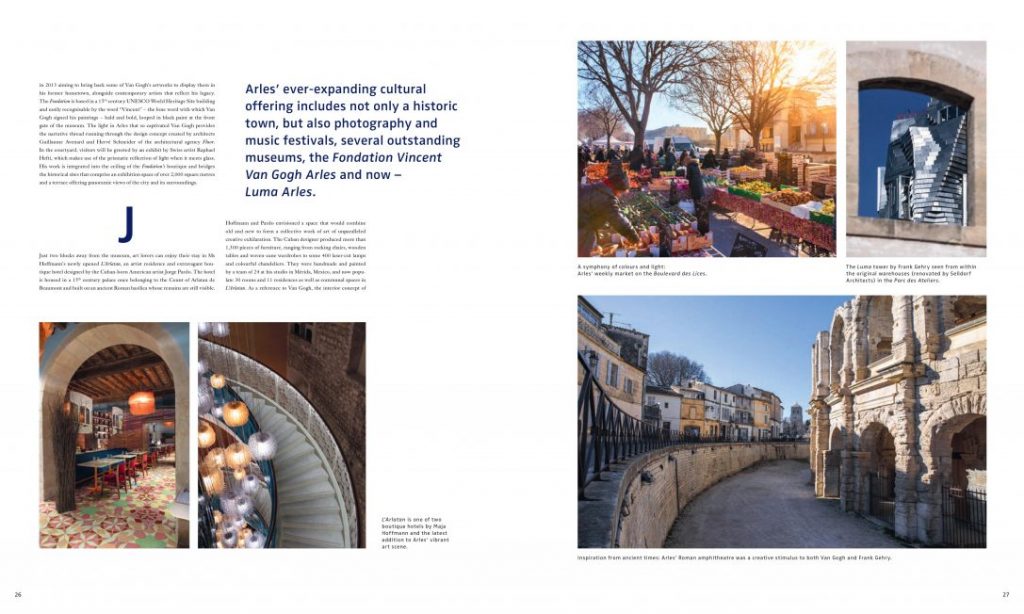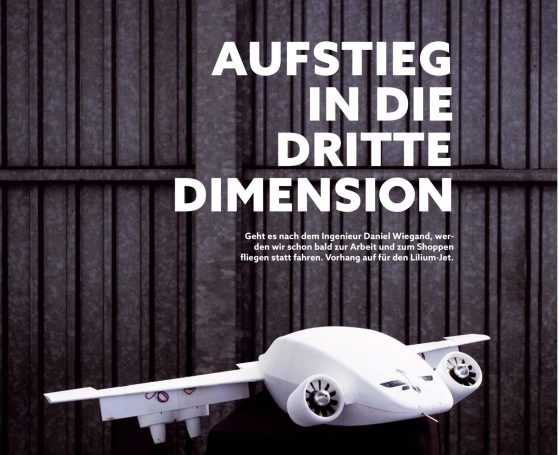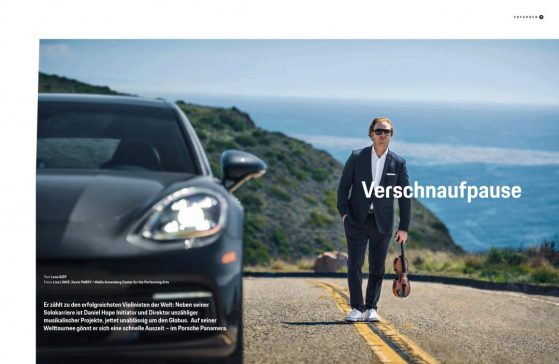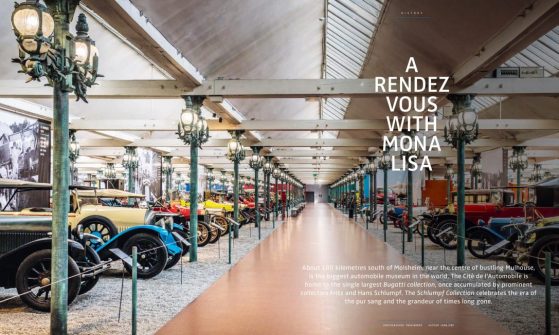Deutsch
“Um dreiviertel elf hab ich hingeworfen, ich weiß es genau.” Uli Hölig steht im August-Horch Museum in Zwickau, in den ehemaligen Hallen von Werk 2, wo er vor fast 30 Jahren seinen letzten Arbeitstag im VEB Sachsenring hatte. Dort, wo früher unter den rhythmischen Metallklängen der Schlagschrauber die Trabis durch die Takte der Endmontage liefen, stehen jetzt hochglänzend polierte Fahrzeugexponate in einem schicken Schauraum aus dunkelgrauem Sichtbeton und Metall. Aber über den Besuchern fällt das Tageslicht immer noch durch die gleichen pyramidenförmigen Dachluken wie damals auf die Arbeiter. Uli Hölig sieht nach oben. “Gänsehaut”, flüstert er. An den Moment, in dem er im Keller der Fabrikhalle den Blechschrank seiner Garderobe zum letzten Mal zutrat, erinnert er sich bis heute lebendig. Wütend war er. Frustriert. Überdrüssig. Fünfzehn Jahre hatte er als “Sachsenringer” gearbeitet, von 1976 bis 1991. Zuerst als gelernter Karosseriebauer, später als Schlosser und LKW-Fahrer. Und das letzte halbe Jahr stand er schließlich am Band in Werk 2 und baute den letzten 1.1ern die Tankstutzen ein. “Nach der Wende waren ja alle in den Westen abgehauen, da mussten auch die Letzten mit ans Fließband, selbst die Sekretärinnen aus den Büros”, erzählt Uli mit hörbar sächsischem Zungenschlag. Von ursprünglich fast 15.000 Arbeitern waren im letzten Jahr nur noch knapp 2.000 übrig. Uli war einer von denen, die geblieben waren. Und die, ein Jahr nach der Wende, nicht wussten, wie es weitergehen wird. Mit ihnen. Ohne Arbeit. Ohne Perspektive. Ohne Trabi.
Uli Hölig schaut nicht zurück. Was vergangen ist, ist vergangen. Deshalb war er auch in den drei Jahrzehnten nach der Wende erst ein einziges Mal im Horch-Museum. Und noch nie in Bautzen, wo sein Vater einsaß und kurz nach seiner Freilassung starb. Und trotzdem fährt Uli Hölig auch heute noch Trabant und reist jedes Jahr zu mindestens fünf Trabi-Treffen in ganz Europa. In der Szene ist er bekannt “wie ein bunter Hund”, sagt der 59-Jährige, nicht ohne Stolz. “Der Trabi ist mein Lebenselixier.” Dabei wollte Uli lange Jahre nichts mehr von Trabis wissen. Nach der Schließung des Werks fand er einen Job bei VW. Aber schon bald erkrankte er an Bauchspeicheldrüsenkrebs und musste frühzeitig in Rente gehen. Als er 2015 in die Kur nach Boltenhagen fuhr, entdeckte er vor der Tür des Hotels einen zweitaktigen Ost-Gefährten. Und dann noch einen. “Ich geh mal hin”, sagte er zu seiner Frau. Und kam von seinem ersten Trabi-Treffen mit einem Entschluss zurück: “Ich kauf mir wieder einen”. Es wurden zwei. Ein pechschwarzer und ein Bentley-grünes Cabrio, beide mit edlen Chromleisten, komplett ausgestattet mit passenden Anhängern, Dachzelten und DDR-Memorabilien. Mit den Trabis verbringt Uli beinahe seine gesamte Freizeit. Die Aufbereitung ist kein Problem. Schließlich hat der gelernte Schlosser zeitlebens an Trabis geschraubt und im Werk jahrelang Teile stibitzt. “Gemaust haben wir, wie die Raben”, lacht er. Das kommt ihm heute zugute. Er ist Teil eines Netzwerkes aus Trabi-Pannenhelfern, die liegengebliebenen Gefährten aus der Patsche helfen. Uli ist zuständig für den Raum Zwickau und steht auch gern mal nachts auf, wenn Not am Mann ist. “Wenn ich den Trabi nicht hätte, wär ich schon lange tot”, da ist er sich sicher.”
Auszug aus einem Beitrag für “Trabi Love”. Erschienen im Delius Klasing Verlag 2019.